Leinengewebe - welche sind die nachhaltigsten? Teil 2
Was bedeutet ‚am nachhaltigsten‘ bei einem Gewebe wie Leinen aus Ponysicht? Nun, genau darüber möchte ich in diesem zweiten Teil über Leinengewebe berichten. Ging es im ersten Beitrag noch darum, generell verschiedenste Leinengewebearten und deren Zusammensetzung zu unterscheiden – um diejenigen Stoffe aussortieren zu können, die nur anteilig aus Leinengarnen bestehen – schildere ich in diesem Blogartikel, worauf ich beim Kauf von Meterware aus 100% Leinen inzwischen achte und warum.
Hinterm grünen Pony liegt ein Weg im Sattel, der – umschreiben wir es mal freundlich – hie und da mit gewissen Stolpersteinen gepflastert war. Jede/r hat individuelle Ansprüche an Textilgewebe – die zukünftigen Pony-Nähprojekte sollten aus dem umweltfreundlichsten, variantenreichsten und Tierleid-freiesten Naturstoff sein, den es so gibt.
Deshalb Leinen – und kein Hanf (noch zu wenig Varianten), kein Ramie (wunderschön aus Brennnessel, doch heute leider nahezu ausschließlich aus Übersee), keine Seide (15 Seidenraupen für ca. 1 g Stoff) und keine Wollarten (die teilweise den jeweiligen Lebend-Tieren rabiat von der Haut gezogen werden).
Wenn ich schon – aus dem frustrierenden Mangel an Eco-XL-Mode-Angeboten heraus – damit beginne, meine Oberbekleidung nun selbst herzustellen, dann richtig.

Foto von Sies Kranen auf Unsplash
Die Sache mit der Entsorgung von Bekleidung nach Stoffarten
Ganz zu Beginn meiner Überlegungen stand natürlich die Wiederverwendung von entsorgten Leinen-Textilien. Doch wie kommt frau/man daran? Das Chaos vor und in Altkleider-Containern spiegelt die derzeitige Situation perfekt wider.
Alles mögliche wird einfach zusammen in die Tonne geschmissen und darauf spezifizierte Entsorgungs- und Verwertungsunternehmen stehen vor ganz anderen, die Umwelt belastenden Problemen (stetiger Rückgang der Qualität der Ware, Weitersendung und -verkauf sortierter Ware in andere Kontinente und wieder zurück etc.), da rückt der Gedanke nach einer Sortierung nach Textilart schnell in Richtung utopischer Wunsch. Oder vielleicht doch nicht? Im März 2024 gab das Europäische Parlament diese Vorschläge für Änderungen an den Vorschriften für Textilabfälle bekannt (im Abschnitt ‚EU-Maßnahmen für Textilabfälle‘).
Die Modeindustrie viel stärker in die Verantwortung zu nehmen, das ist ein gigantisches Thema. Bis zur tatsächlichen Umsetzung kann jede/r Einzelne im Alltag selbst – nur durch einen bewußten Kaufentscheid oder eben Nicht-Kauf – diesen Weg mit beeinflußen und damit eine Veränderung unterstützen.
Für meine Idee von nachhaltiger, eleganter und unikaler Eco-XL-Mode suchte ich jedoch einheitliche Stoffe in variierenden Farben, Dichten und Gewichten – flächenmäßig ausreichend, für eben XL-Oberteile. Damit stand ich jetzt vor der Frage: „Wo finde ich genau solche Leinenstoffe? Und wieder war (für mich) eine Vorab-Sortierung wichtig.
Welche Kriterien sollte Leinenstoff im Optimalfall erfüllen?
Eigentlich sind es keine großen Anforderungen, die ich an das Leinengewebe stelle mit dem ich arbeiten möchte, nämlich:
Gewebe aus 100% Leinen
aus europäischer Produktion
mithilfe einer Tauröste, und nicht über eine Wasserröste hergestellt
in variierenden Farben, in Europa gefärbt (möglichst zertifiziert nach GOTS-Standard)
von herausragender Qualität
auch in kleineren Mengen zu bekommen
Mit der Entscheidung für Leinen aus europäischer Produktion, sinkt schon mal das Risiko, das die Flachsfaser zur Herstellung des Gewebes eine sogenannte Wasserröste durchlaufen hat. Diese erfolgte früher mehrheitlich in Flüssen, wodurch diese sich gelb färbten; heute wird sie offenbar noch vereinzelt – vorwiegend in wärmeren Ländern, die nicht auf die Tauröste zurückgreifen können (fehlender Niederschlag) mit hohem Wasserverbrauch durchgeführt. Welche – ggf. auch europäische Länder – diese Wasserröste zur Flachsfaserverarbeitung heute noch effektiv einsetzen, konnte ich nirgends exakt ermitteln.
Auch einen diesbezüglichen Hinweis sucht frau/man auf angebotenem Leinengewebe in Meterware vergebens. Worum es sich bei diesen zwei Verfahren jeweils handelt, wird hier sehr gut erklärt.
Der nächste Punkt auf der Pony-Liste der Kriterien ist kein einzelnes Cavaletti, über das mit einem lässigen, eher faulen Hüpfer rübergetrippelt werden kann, sondern mehr als ein massives Doppelhindernis mit einem verstecktem Wassergraben dazwischen – um mal in der Pferdesportsprache zu bleiben.
Unterschiedliche Leinengewebe in einer breit aufgestellten, variierenden Farbenvielfalt sowie inklusive GOTS-Zertifizierung zu finden, dieses Unterfangen entpuppte sich als der reinste Hindernisparcours.

Foto von Karolina Badzmierowska auf Unsplash
Was das GOTS-Siegel ist und was es alles beinhaltet, ist auf deren Website ausführlich erklärt. In einem kurzem Überblick stellt sich dieses Textilsiegel für Verbrauchende so dar. Alles gut bis hierhin, diese Initiative ist ein sinnvoller Schritt (von vielen notwendigen) hin zu einem Umdenken in der Textilindustrie und sicher unterstützenswert. Wenn sich – zwischen einem GOTS-zertifizierten Bekleidungsstück und einem gleichen, nicht GOTS-zertifizierten – entschieden werden müßte, wäre ersteres vielleicht eher die Ponywahl.
Abgesehen davon, dass ökologisch hergestellte XL-Mode kaum existiert und damit GOTS-zertifizierte Ware nur im geringen Maße im Angebot zu finden ist – stellt sich diese Frage allerdings nicht allzu häufig. Auch Bekleidungsteile mit GOTS-Siegel sind oftmals ‚Made in Bangladesh‘ oder kommen aus anderen, weit entfernt liegenden Ländern.
Leinen in sogenannter Bio-Qualität (also mit diesem Siegel) wird als Meterware angeboten – Sie werden jedoch bestimmt schnell feststellen, dass bei der vorhandenen Farbauswahl nicht von einer breiten Palette gesprochen werden kann. Womit der gleiche Status wieder erreicht wäre, der einer von mehreren Gründen ist, warum es nun das grüne Pony überhaupt gibt.
Kann Färben umweltfreundlich sein? Ein kurzer Exkurs
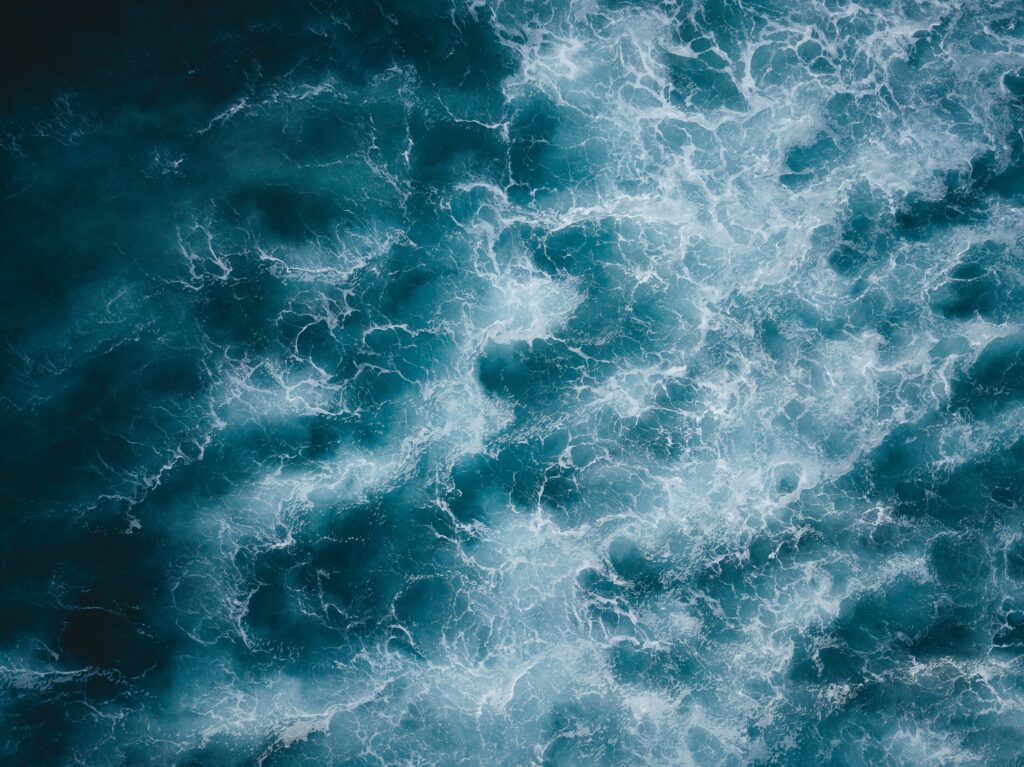
Foto von Ivan Bandura auf Unsplash
Das Färben von Textilien hat sich ab dem Jahr 1856 grundlegend verändert, denn der damals 18-jährige Brite William H. Perkin entdeckte per Zufall bei einem chemischen Experiment den ersten synthetischen Farbstoff Mauveine (namensgebend ist wohl die rosig-fliederfarben blühenden Pflanze Malve, Quelle: Wikipedia). Diese Erfindung gilt als Keimzelle der chemischen Farbenindustrie und das Färben mit synthetischen Farben ersetzte jenes, dass sich der Farben aus der Natur bediente.
Seit jeher färbt der Mensch seine Textilien. Der Wunsch, sich über eine oder mehrere Farben in seiner Bekleidung auszudrücken, erfüllte sich zunächst mit Farbstoffen, die aus Pflanzen gewonnen werden. Bleiben wir als ein Beispiel für eine mögliche Natur-Farbgewinnung bei einem Lila – auch um besagtem Mauveine in der Farbskala etwas zu ähneln.
Für die Herstellung in privaten Farbenküchen wurden früher wahlweise dafür verwendet: Blauholz (vom Blutholzbaum, heimisch in Zentral- und Südamerika), Brombeere, Chochenille (von der ebenfalls in Südamerika heimischen Chochenilleschildlaus, 60.000 – 100.000 Schildläuse für 50 g Karmin), Lackmus oder Orseille (ein Brei aus Wasser und der Roccella Tinctoria-Flechte, welche auf den Felsen Makronesiens wächst), Gallapfel (Wucherung an einer Eiche, die durch die Gallwespe entsteht, die dort ihre Eier/Larven ablegt), Pflaume, Färberwaid (eine ursprünglich aus Zentralasien stammende Pflanze aus der Familie der Kreuzblütengewächse, welche seit der Eisenzeit auch hierzulande zum Färben eingesetzt wurde) oder kostbares Indigo (organisches Piment, gewonnen aus der Indigopflanze, beheimatet in Indien, China und dem tropischen Afrika).
Naturfärberei – dieser Begriff zeigt an, dass es sich dabei um einen Färbe-Prozess handelt, der ausschließlich mit in der Natur vorhandenen Ressourcen durchgeführt wird. Schaut man sich die Liste von dazu ebenfalls einst verwendeten Beiz- und Färbehilfsmittel (Alaun, Ameisensäure, Birkenasche, Eisensulfat, Essigessenz, Gallapfelpulver, Gelatine, Hydrosulfitpulver, Kaliumdichromat, Kalk, Kupfersulfat, Natronlauge, Phenolphthalein, Pottasche, Rauchende oder konzentrierte Schwefelsäure, Ammoniak, Natriumchlorid, Salz, Sauerampfer, Soda, Sternmiere, Urin vom Menschen, Weinessig, Weinsteinrahm, Weizenkleie, Zinnchlorid) an, damit wasch- und lichtechte Färbungen entstehen, wird deutlich, dass sich Dämpfe aus den darunter giftigen Substanzen entwickeln können, die besser nicht direkt eingeatmet werden sollten. Nicht alle daraus entstehenden Beiz-Abwässer lassen sich ohne Sondermülldeklarierung entsorgen.
Generell ist beim Färben also ein gewisser chemischer Prozess notwendig um eine bestimmte Farbe zu er- und behalten, es sei denn ich lege mein T-Shirt – salopp formuliert – einfach in Brombeersaft und nehme in Kauf, dass es danach verschiedene Farbnuancen hat sowie nach der ersten Wäsche womöglich eher grau aussieht. Und natürlich wird zusätzlich Wasser (im Idealfall weiches Fluss- oder Seewasser oder besser aufgesammeltes Regenwasser) benötigt, denn die Beschaffenheit des Wassers ist für die Naturfärberei wichtig.
Um beispielsweise rund 1.000 g Wolle nach so einem althergebrachten Rezept zu färben, braucht es rund 20 Liter solchen Wassers.
Textilien, die mit Naturfarben gefärbt worden sind, haben allerdings im Vergleich zum Färben mit synthetischen Farben, einen entscheidenden Vorteil: sie belasten die Umwelt – gesamthaft betrachtet – weitaus weniger (vorausgesetzt anfallende Abwässer werden nicht einfach in Flüssen entsorgt), denn die verwendeten Ingredienzien sind biologisch abbaubar. Allerdings haben sie auch einen wesentlichen Nachteil: ihre Farbpalette bleibt begrenzt und es können niemals leuchtende oder gesättigte Farben erzielt werden.
Färben mit synthetischen Farben – von der Naturfärberei nun zur Petrochemie. Seit William H. Perkin seine Entdeckung machte, färbt der Mensch hauptsächlich im großen Stil industriell und produziert damit – vor, während und nach – dem eigentlichen Färbeprozess Substanzen und Partikel, die sich nicht mehr oder schwer biologisch abbauen lassen.
Somit gelangen diese letztendlich (weil nicht alle über Kläranlagen filterbar sind oder sie erst garnicht solchen zugeführt werden, wie in manchen Regionen außerhalb Europas) wieder in unsere Meere, Flüsse, Trink- bzw. ins Grundwasser – wodurch Ökosysteme stark beschädigt und der Lebensraum von Tieren, Pflanzen und Menschen bedroht wird. Ähnlich wie Plastik, doch oft unsichtbar.
Der enorme Wasserverbrauch für jeden der – für eine Färbung nach diesem Prinzip – notwendigen, einzelnen Schritte ist ein weiterer, unfassbar großer Raubbau an der Natur.

Foto von Anders Ipsen auf Unsplash
Im Pony-Parcours zu nachhaltigen, farbenfrohen Leinenstoffen stellte sich das Färben von Gewebe als ein überdimensionales Hindernis heraus, das sich – wenn überhaupt – nur ‚umweltverträglich‘, jedoch niemals umweltfreundlich überwinden lassen würde, sofern ich daran festhielt, meine Vorstellung von ansprechender Eco-XL-Mode umzusetzen.
Zugegeben, ein echter Gewissenskonflikt. Auch, wenn es seit ein paar Jahren Versuche gibt, in denen sich mit Algen ein vielleicht ökologisch vertretbareres Färbeziel erreichen lässt, finden sich derzeit – nach diesem Prinzip gefärbte Leinengewebe – noch nicht als Meterware unter den Kaufangeboten.
Auf dem Weg der Entscheidungen zu künftig verwendeten Leinenstoffen
Bei meinem gefassten Entschluss selbst zu nähen, um etwas Schönes und gleichzeitig Umweltorientiertes in XL zu gestalten, wollte ich mich nicht auf ein paar wenige Farben reduzieren. Gestalten oder ein Design entwickeln bedeutet (nicht nur für mich) auf die ganze Bandbreite eines vorhandenen Farbspektrums zugreifen zu können. Das beflügelt die Fantasie, vermittelt Freude beim Entwerfen und trägt zur Erschaffung von etwas Unikalem beträchtlich bei.
Zu lange habe ich mich in der Vergangenheit mit dem begnügen müssen, was „freundlicherweise“ in großen Größen zur Auswahl stand. Genau das will ich ja verändern, wie ich in meinem ersten Blogbeitrag und im Übers Pony bereits mitteilte – und zusätzlich so Eco wie eben möglich.
In der Konsequenz hielt ich zu Beginn nur Ausschau nach GOTS-zerfiziertem Leinenstoff. So genannte Bio-Leinen-Meterware findet sich bei diversen Anbietern, wobei ich feststellen ‚durfte‘, dass nicht jede/r Anbieter/in (selbst große, bekannte Händler, aber auch kleinere) das Zertifikat auf Nachfrage dann auch vorweisen kann. In einem Fall bin ich persönlich sogar ganz bis England gereist, um vor Ort festzustellen, dass ein Zertifikat für die nach deren Angaben unter GOTS-Auflagen erfolgte Färbung ihrer Leinenstoffe, nicht existierte. In einem anderen erhielt ich per E-Mail die Auskunft, dass man/frau sich als kleines Unternehmen die GOTS-Zertifizierung (ca. 150 Euro pro Jahr) nicht leisten könne (oder einfach nicht will).
Meinen nächsten Versuch, Leinen – als Hobbyista wohlgemerkt – zumindest nach Oeko-Tex®-Standard in Europa färben zu lassen, startete ich in Litauen. Das dort ansässige Unternehmen offeriert ab Abnahme einer bestimmten Meteranzahl eine Färbung nach Wunschfarbe aus dem gesamten Pantone®-Spektrum. Leider dauerte es nahezu zwei Monate bis die zwei Leinenstoffe, die ich mir hatte färben lassen, eintrafen. Die Färbung war gelungen, doch die Qualität des Leinens entsprach nicht meinen persönlichen Ansprüchen. (Anmerkung: Seit dem 1. April 2024 gibt es Neuregelungen bei Oeko-Tex® in punkto Grenzwerte in seinen unterschiedlichen Zertifizierungsmöglichkeiten. Besagtes litauische Unternehmen ist im Übrigen nun nicht mehr dabei.)
Anders bei Mind the Maker – hier stimmte die Qualität des Leinengewebes. Es ist sowohl nach Oeko-Tex®-Standard und viel wichtiger (für mich) aus Flachs nach der European Flax® Alliance zertifiziert. Allerdings ist die Farbauswahl – für Hobbynäher/innen – relativ begrenzt und die Stoffmeter sind nicht direkt bei Mind the Maker, sondern nur über deren Vertriebspartner/innen zu ergattern.
Eher per Zufall stieß ich dann auf eine andere Möglichkeit: Überschüsse aus der Textilproduktion – darunter auch 100%tige Leinenstoffe in guten Qualitäten – bietet Fabric-House an. Mit dem CFS-Siegel (Circular Fabric Standard) unterstützt dieses Unternehmen den Warenkreislauf insofern als dass textile Überproduktionen etwaigen Gestaltern/Gestalterinnen, Näherinnen/Nähern und somit letztendlich dem/der Endverbraucher/in wieder zugeführt werden. Und nicht einfach entsorgt werden. Besser wäre es natürlich, wenn es diesen Überhang an produzierten Textilstoffen erst garnicht gäbe.
Zur Info, ich habe mir deren Verkaufsraum in Düsseldorf ebenfalls persönlich angeschaut, einfach weil ich es wichtig finde, online mit real abzugleichen. Detaillierte Auskünfte zu Produktionsstätten bzw. -verfahren zu einzelnen Leinenstoffen ließen sich im Gespräch mit dem freundlichen und engagierten Werksstudenten, der den Store betreute, leider nicht exakt ermitteln – was auch dem insgesamt vorhandenen sehr großen Angebot an unterschiedlichsten Stoffarten geschuldet sein dürfte. Meine Leinenstoff-Meter – auf Papprollen bestellt – kamen dann direkt aus der Zentrale in Italien, eingewickelt in sehr viel Plastik. Der Verpackungspunkt ließe sich noch verbessern.
Und dann endlich, fand ich das, wonach ich suchte. Qualitativ hochwertige, unterschiedlichste 100% tige Leinengewebe aus europäischer Produktion in Naturfarben als auch in weiteren Farben. Belgisches Leinen vom Feinsten oder leichtere, italienische Leinenstoffe – einige sogar nach GOTS, einige mehr nach dem European Flax Standard zertifiziert. Wunderschönes Leinen, auch für Hobbynäher/innen im Verkauf, in der Nähe von Gießen. Bisher kommt dieses Leinen den Pony-Vorstellungen am nächsten.

Foto von Jens Lelie auf Unsplash
Kleines Pony-Fazit zu Leinengewebe, die am nachhaltigsten sind
Bitte verstehen Sie mich richtig, ich möchte den Punkt des Färbens auf keinen Fall klein schreiben, denn es ist ein umweltverschmutzender Faktor. Der Pony-Kompromiss wird daher sein, dass zwar farbige Leinenstoffe künftig verwendet werden – doch bewußt auf Herkunft und Qualität geachtet wird, und zudem nur eher kleine Stoffchargen für konkrete Ideen (nach Sichtung einer vorliegenden Musterkarte) bestellt werden.
Darüber hinaus kann ein naturbelassenes Leinengewebe ja auch mit Stickereien bunt und doch elegant verziert werden. Beim Stickgarn (das ja auch gefärbt wurde) ist die Pony-Wahl bereits auf ein Maschinen-Stickgarn aus TENCEL™ Lyocell-Fasern (laut Garn-Hersteller biologisch abbaubar, aus nachhaltig gewachsenem Holz hergestellt, mit nur einem Bruchteil an Wasserverbrauch im Vergleich zu bspw. Baumwollgarn gefallen, das in einem nachhaltigen Produktionsverfahren aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt wird). Firmensitz des Herstellers ist in Freiburg, ob das Garn auch in Deutschland produziert, nach welchen Methoden es gefärbt wurde und ob es nicht nur hierzulande nicht nur noch verpackt wird, ließ sich leider fürs Pony nicht genauer ermitteln.
Zusammenfassend läßt sich aus Pony-Sicht feststellen, dass generell mehr Transparenz wünschenswert wäre. Ich persönlich möchte wissen, woher der Stoff oder das Gewebe stammen, ob es übermäßig viel Wasser oder Energie für seine Herstellung verbrauchte oder wie oft es in der Weltgeschichte hin und her geschickt wurde, bis es als fertiges Gewebe zur Verfügung steht. Ebenso sollten in Aussicht gestellte Siegel auch tatsächlich vorhanden sein, denn Greenwashing ist einfach nur kontraproduktiv.
Mit der Pony-Entscheidung, künftig ausschließlich mit dem Gewebe Leinen – einem langlebigen Material, wenn nicht sogar dem langlebigsten Stoff unter den Naturstoffen überhaupt – etwas zu gestalten, ist als solches schon eine nachhaltige Wahl gefallen.
Alle Pony-Hufe hoch – für ausschließlich qualitativ hochwertiges, europäisches Leinen (ohne Wasserröste) – ist eine weitere Unterstützung in Sachen Nachhaltigkeit. Der Verzicht auf etwaige Mischgewebe der nächste eco-freundlichere Beschluss. Vor Ort selbst zu nähen ein klares Ja zum Verringern des CO2-Fußabdrucks. Gefärbte Leinenstoffe ebenfalls zu nutzen ist der einzige, größere Nachteil aus Umweltaspekten, den es durch ein bewußtes Abwägen vor jedem Kauf auf ein Minimum zu reduzieren gilt. Wenn daraus dann ein besonders schönes Stück gelingt, freut sich das grüne Pony umso mehr.
Mit meinen zwei Beiträgen wollte ich den Blick etwas tiefer in die Materie lenken und hoffe, dass mir das gelungen ist. Hier ist es schon leicht angeklungen, im nachfolgenden Ponyblog-Artikel geht es erstmals um Leinenstickerei à la grünes Pony .

Foto von Mona Eendra auf Unsplash